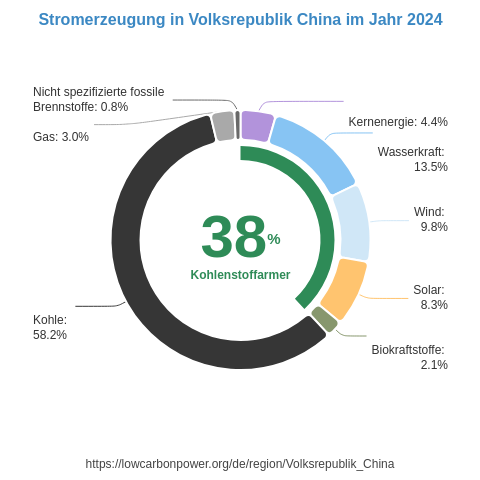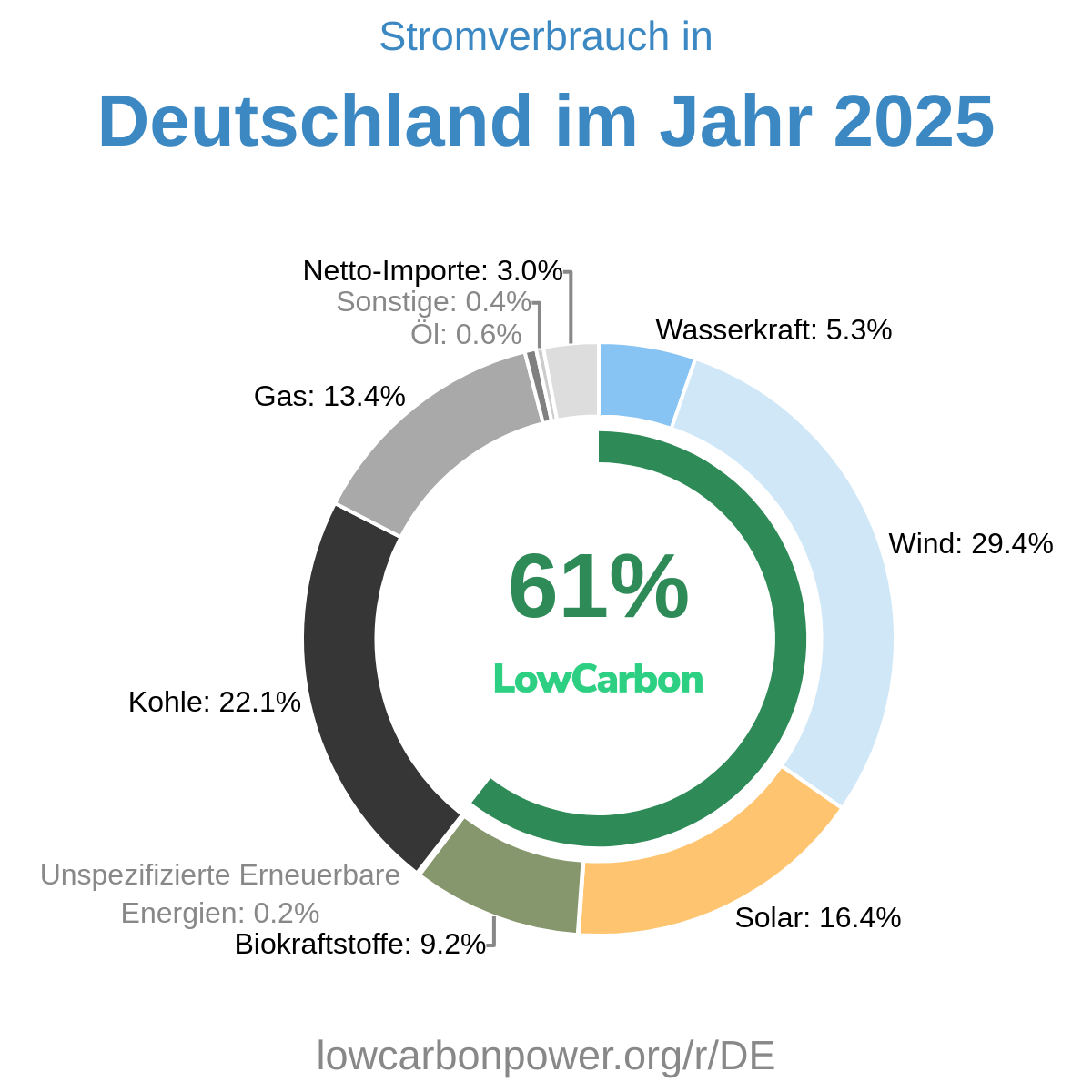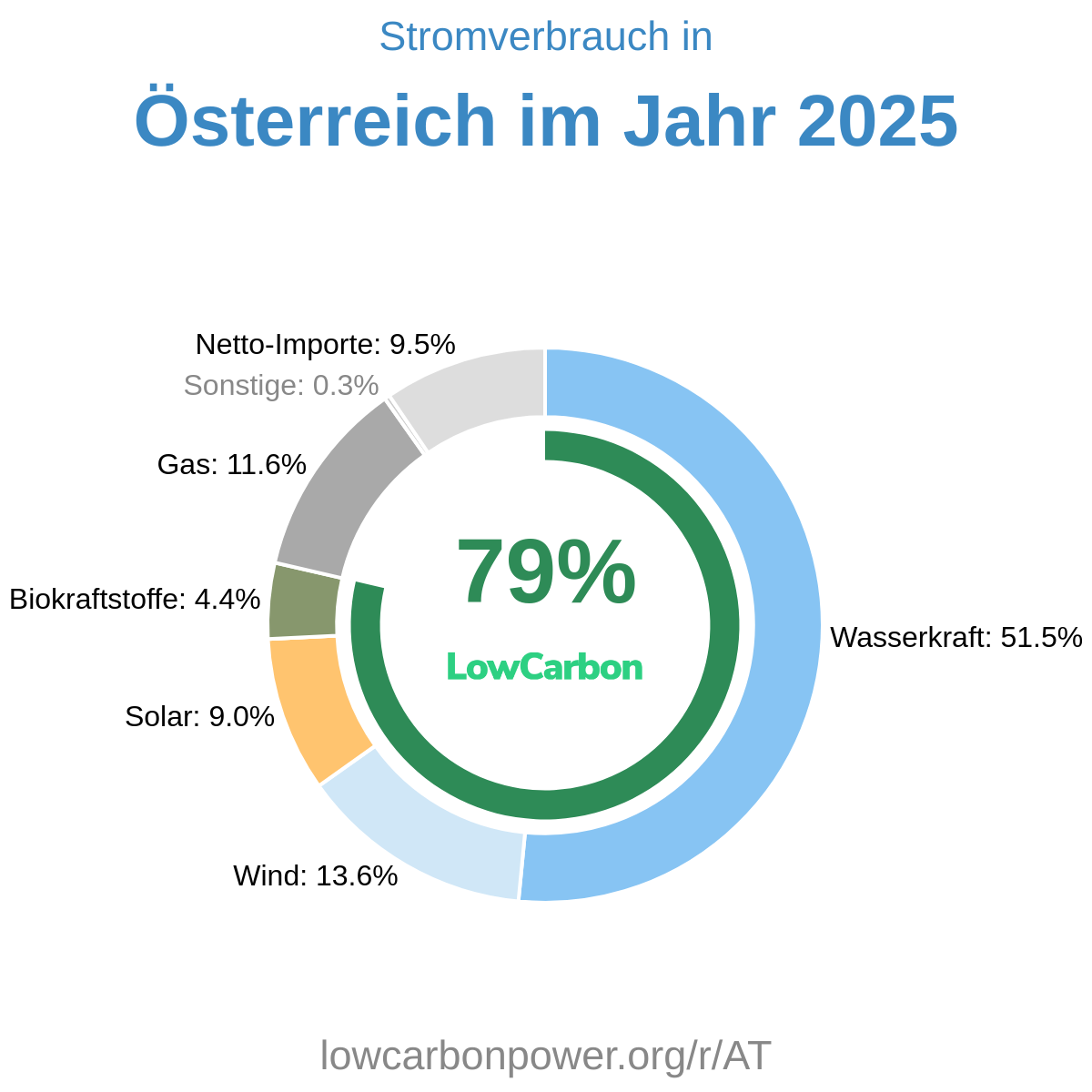Estland setzt derzeit auf eine vielfältige Mischung von Energieströmen, um seinen Elektrizitätsbedarf zu decken. Mehr als ein Drittel der gesamten Elektrizität wird durch Netto-Importe gedeckt, was die Abhängigkeit Estlands von ausländischer Energie zeigt. Kohlenstoffarme Energiequellen machen mehr als ein Drittel des Verbrauchs aus, wobei Wind und Solar die Hauptakteure sind. Die große Mehrheit dieses Anteils entfällt auf Wind- und Solarenergie, die insgesamt fast 30% der gesamten Elektrizität ausmachen. Fossile Brennstoffe tragen mit einem Anteil von knapp einem Viertel ebenfalls erheblich zur Elektrizitätsproduktion bei, wobei Öl den größten Anteil hat. Kohle hingegen macht nur einen kleinen Teil aus, was den Trend zu einer saubereren Energieproduktion widerspiegelt.
Die auf dieser Seite verwendeten Datenquellen umfassen Energy Institute, ENTSOE, Eurostat und IEA. Mehr über Datenquellen →
Wächst der Strom in Estland?
Der derzeitige Elektrizitätsverbrauch in Estland liefert jedoch Anlass zur Sorge. Im Vergleich zum historischen Höchststand von 11.690 kWh pro Person im Jahr 1986 ist der aktuelle Verbrauch auf 5.648 kWh pro Person gesunken. Diese wesentliche Reduzierung zeigt eine ernsthafte Stagnation in der Elektrizitätsnutzung und wirft Fragen zu Kapazität und Wirtschaftswachstum auf. Das kohlenstoffarme Elektrizitätsaufkommen ist ebenfalls zurückgegangen, von 2.395 kWh pro Person im Jahr 2024 auf 2.074 kWh im Jahr 2025, was eine beunruhigende Tendenz ist. Angesichts des wachsenden Bedarfs nach Elektrifizierung und den Herausforderungen des Klimawandels ist es entscheidend, dass Estland seinen Elektrizitätssektor neu belebt.
Vorschläge
Um die Produktion kohlenstoffarmer Elektrizität zu steigern, sollte Estland seine bestehenden Kapazitäten in Wind- und Solarenergie ausbauen, den Bereichen, in denen bereits beträchtliche Anteile produziert werden. Die Erfahrungen von Regionen wie Iowa und Dänemark, wo ein erheblicher Teil der Elektrizität aus Wind gewonnen wird, können richtungsweisend sein. Auch die Einführung von Kernenergie könnte entscheidend zur Diversifizierung und Stabilisierung des Energieangebots beitragen. Länder wie Frankreich und die Slowakei, die einen Großteil ihrer Elektrizität aus Kernenergie gewinnen, bieten Beispiele für den erfolgreichen Einsatz dieser kohlenstoffarmen Technologie. Diese Strategien gemeinsam könnten Estland helfen, eine stabilere und nachhaltigere energetische Grundlage zu schaffen.
Geschichte
Ein Blick auf die Geschichte der kohlenstoffarmen Elektrizität in Estland zeigt, dass das Wachstum oft mit Schwankungen verbunden war. In den frühen 2010er Jahren erlebten die Biokraftstoffe ein Moderates Wachstum, mit kleinen, aber stabilen Zuwächsen, während sie in den letzten Jahren mit leichten Rückgängen zu kämpfen hatten. Wichtig ist die Entwicklung der Solar- und Windenergie, die gerade in den Jahren 2020 bis 2025 sichtbare Fortschritte gemacht haben. Die letzten Jahre zeigen jedoch auch einige Rückschläge, insbesondere bei den Biokraftstoffen. Es ist klar, dass Estland in der Vergangenheit erhebliche Anstrengungen unternommen hat, aber zukünftige Investitionen sollten sich stärker auf nachhaltige Optionen wie Wind, Solar und möglicherweise Kernenergie konzentrieren, um den Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte begegnen zu können.