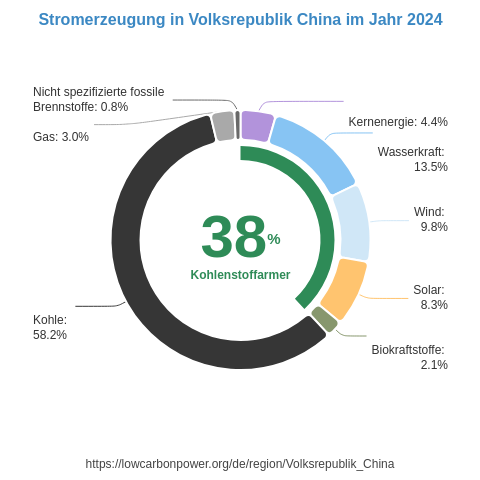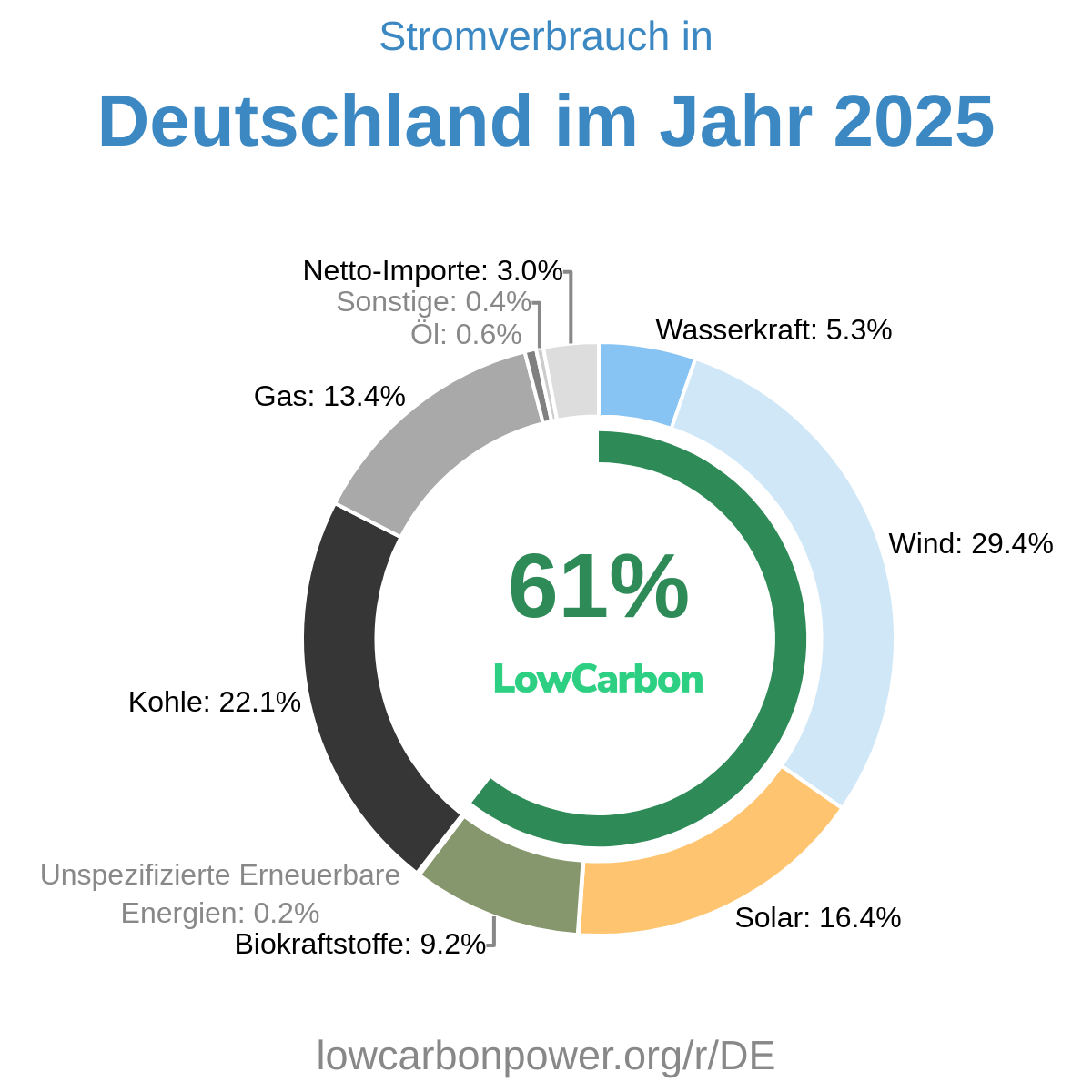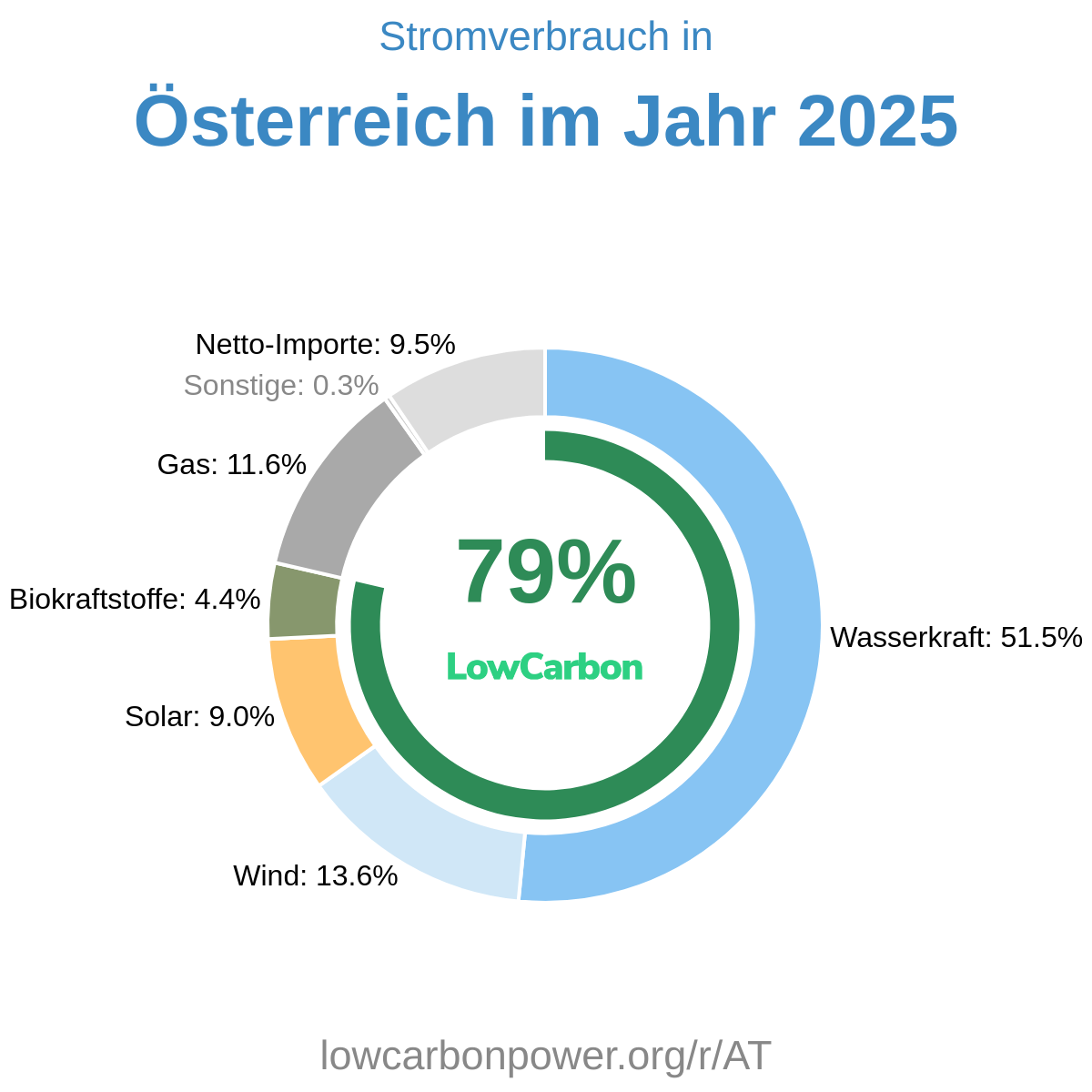Elektrizität in Aserbaidschan im Jahr 2024
Der aktuelle Stand des Stromverbrauchs in Aserbaidschan im Jahr 2024 zeigt eine deutliche Dominanz fossiler Brennstoffe, insbesondere von Gas, das fast den gesamten Verbrauch dieser Kategorie abdeckt. Mehr als 88 % des Stroms wird aus fossilen Energieträgern erzeugt, wobei Gas mit fast 88 % eine dominante Rolle spielt. Auf der anderen Seite kommt der kohlenstoffarme oder saubere Strom aus Wasserkraft und Solarenergie, gemeinsam machen sie etwa 12 % des Strommixes aus. Die Wasserkraft trägt fast 10 % bei, während die Solarenergie ein bescheidenes, aber bedeutendes Wachstum zeigt, indem sie etwa 1,4 % zum Stromverbrauch beiträgt. Daten dieser Art ermutigen dazu, die Bemühungen zur Steigerung des Anteils an sauberem Strom zu verstärken.
Die auf dieser Seite verwendeten Datenquellen umfassen Ember, Energy Institute und IEA. Mehr über Datenquellen →
Wächst der Strom in Aserbaidschan?
Bei der Betrachtung des Wachstums des Stromverbrauchs in Aserbaidschan ist festzustellen, dass der Pro-Kopf-Stromverbrauch im Jahr 2024 mit 2818 kWh immer noch unter dem historischen Höchststand von 3329 kWh aus dem Jahr 1988 liegt. Diese Abnahme von mehr als 500 kWh deutet auf eine Stagnation oder sogar einen Rückgang der Stromnachfrage hin, was bedenklich ist, wenn man das bestehende Potenzial für Elektrizität in der wirtschaftlichen Modernisierung betrachtet. Ähnlich ist die Erzeugung kohlenstoffarmen Stroms mit einem Rückgang von 40 kWh pro Person seit 2010 ein Zeichen dafür, dass Aserbaidschan Anstrengungen zur Erhöhung dieses sauberen Stromanteils unternehmen muss, um die Weltklimanormen und die Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen.
Vorschläge
Aserbaidschan kann den Anteil kohlenstoffarmen Stroms erhöhen, indem es sich Strategien aus den erfolgreichen Regionen der Welt zu eigen macht. Der Ausbau der Kernenergie bleibt eine hervorragende Option, wie von Ländern wie Frankreich, der Slowakei und der Ukraine demonstriert, die dies mit Anteilen von 70 %, 66 % bzw. 55 % an der Stromproduktion erfolgreich umgesetzt haben. Ein Fokus auf Solarenergie könnte helfen, da Kalifornien und Nevada gezeigt haben, dass 29 % bzw. 33 % aus Solarstrom gewonnen werden können. Es wäre klug, sowohl Solar- als auch Kernenergie aufgrund ihrer Effizienz und ihres Beitrags zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes verstärkt in den Energiemix zu integrieren.
Geschichte
Ein Blick in die Geschichte der kohlenstoffarmen Stromerzeugung in Aserbaidschan zeigt, dass in den 1980er Jahren bedeutende Schwankungen in der Wasserkraftnutzung zu verzeichnen waren. Die 1990er Jahre brachten stabile Zuwächse, während in den frühen 2000er Jahren leichte Aufschwünge dominieren. Besonders bemerkenswert ist das Jahr 2010, das einen Anstieg von 1,1 TWh in der Wasserkrafterzeugung verzeichnete, gefolgt von einem Rückgang in den darauf folgenden Jahren. Im Jahr 2024 sieht man jedoch wieder deutliche Steigerungen sowohl in der Wasserkraft als auch in der Solarstromproduktion, was einen positiven Trend für die künftige Energiepolitik in Aserbaidschan signalisiert, den es weiterhin zu fördern gilt.